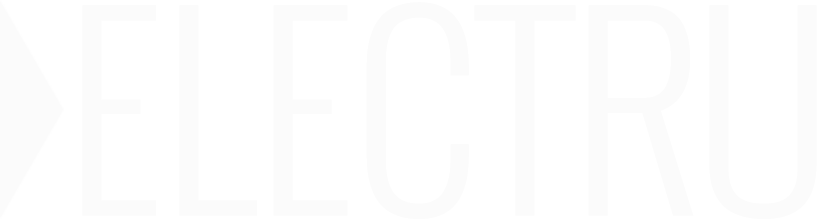Im Rahmen der Liquida Studio Residency begab sich der Berliner Fotograf einen Monat lang auf Entdeckungstour durch die sizilianische Stadt Palermo. Wie Dichtervater Goethe sich hier vor über 200 Jahren auf die Suche nach der imaginären „Urpflanze“ machte, wandelte auch Torsten Schumann in Palermos urbaner Landschaft, um das visuelle Eigenleben der Stadt zu enträtseln. Dabei inszenierte er seine Bilder nicht, sondern ließ sich von der Magie des Zufalls und der Stimmung seiner Umgebung mitreißen. Seine Arbeit findet diese Woche mit einer Ausstellung im Minimum Studio Palermo ihren Höhepunkt. Ich traf den Fotografen über den Dächern der Stadt zu einem Interview und redete mit ihm über die Wesentlichkeit des Details sowie das Wunder von Palermo. Inspiriert von unserem Gespräch fielen mir am Ende erneut Goethes weise Worte ein: „Dass ich Sizilien gesehen habe, ist mir ein unzerstörlicher Schatz auf mein ganzes Leben“.
Wie hat alles angefangen?
Irgendwann mit 16 habe ich meine erste Kamera bekommen. Eine Praktika. Das war relativ spät, weil ich aus dem Osten komme. Meine Tante hatte damals bei Pentagon gearbeitet und mir nach der Wende die Kamera geschenkt. Eigentlich war ich schon immer an Technik interessiert und mochte es Dinge zu beobachten. Beim Autofahren saß ich als Kind hinten drin, träumte vor mich hin und schaute raus. Ich malte auch gern. Wenn ich allerdings etwas zeichnen sollte, das sich Leute wünschten, dann spürte ich einen Widerstand in mir. Ich habe dann etwas hingerotzt, was meistens gut war, aber ich hatte dann keine Lust mehr zu malen.


Was hat dich an der Fotografie fasziniert?
Im Prinzip habe ich schon während des Abiturs mit Fotografieren angefangen, aber ohne es ernst zu nehmen. Während meines Zivildienstes, für den ich ein Jahr mein Studium unterbrach, belegte ich dann alle möglichen Kurse in Lithografie, Malerei, Fotografie und Bildhauerei. Ich habe verschiedenes ausprobiert, bin aber immer wieder zurück zur Fotografie gekommen. Vielleicht weil ich ziemlich neugierig bin und gerne an verschiedenen Orten etwas Neues entdecke. Dabei hilft die Fotografie enorm. Nicht nur nach außen, aber auch in mir selbst. Für mich ist es eine Art Spiel. Das mag ich daran. Ich selbst nehme mich dabei nicht so ernst. Das kann manchmal eine Gratwanderung sein, vor allem wenn man von anderen künstlerisch ernst genommen wird. Es macht mir jedoch einfach Spaß mich auf der Straße zu verrenken und irgendwas zu fotografieren, bei dem ich manchmal selbst denke: „Was soll das?“ Aber dann ich fotografiere einfach und versuche den Zensor im Vorfeld komplett abzuschalten.
Das ist manchmal das Schwierigste oder?
Im Gegenteil. Sobald ich so einen Impuls merke und denke „Nee, das Bild ist doch Quatsch“, dann gibt es eine andere Stimme in mir die sagt: „Gerade deswegen muss ich es jetzt machen!“.

Wie ging es weiter und wie wurde die Fotografie zu einer Berufung?
Weiter ging es mit dem Bau einer Dunkelkammer im Bad unserer WG in Dresden und vielen Ausflügen mit einem Freund Richtung Osten. Am liebsten nach Krakau, wo ich auf der Straße fotografierte. Damals noch in schwarz-weiß. Inspiriert von der klassischen Fotografie der 50er Jahre, wie zum Beispiel Robert Doisneau. Irgendwann war dann klar, dass die erste Ausstellung her musste. Zu fünft und ohne Geld haben wir uns einen geeigneten Raum und Sponsoren gesucht. Danach folgten weitere kleinere Ausstellungen, bis ich 2004 mein Studium der Verfahrenstechnik beendete und in die Eifel zog, um in einem Spanplattenwerk zu arbeiten. Das bedeutete zehn Stunden lang drinnen, ohne viel Licht. Am Wochenende merkte ich die Einsamkeit, die in mir steckte, so isoliert auf dem Dorf. In diesem Moment habe ich wieder fotografiert, in Farbe und mit einer Digitalkamera. In diesen Bildern fand ich mich viel mehr, als in den vorangegangenen Bildern wieder. Sicherlich aus dem Gefühl der Entwurzelung heraus und um der Spießigkeit, die mir begegnete, etwas entgegensetzen. So eine Art Rebellion in mir. Später ging ich zu verschiedenen Experten-Reviews. Bei einer dieser Reviews empfahl mir Markus Schaden einen Workshop bei Wolfang Zurborn. Das war eine Art Durchbruch.
Würdest du jungen Fotografen empfehlen Workshops zu besuchen?
Unbedingt! Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie die finanziellen Möglichkeiten sind. Der Vorteil ist, dass ein Workshop immer intensiv ist und man sich seine Lehrer aussuchen kann. Jedoch sollte man ihn nicht als Einbahnstraße sehen, sondern in viele verschiedene Richtungen denken.
Ich bin damit aufgewachsen das Kleine zu schätzen und nicht immer nach dem Großen zu schauen. In Details steckt oftmals so viel drin, dass sie etwas über den größeren Rahmen, also unsere Gesellschaft und Zeit, Preis geben.
Wovon handeln deine Bilder?
Von der Möglichkeit eigentlich überall etwas entdecken zu können und genauer hinzuschauen. Und zwar nicht nur in die eine Richtung, die andere einem vielleicht vorgeben, sondern es geht darum den Blick zu entwickeln und selbst zu staunen. Ich mag Dinge zu entdecken und vielleicht auch nicht nur das zu fotografieren, was da ist, sondern mich selbst einzubringen. Gleichzeitig erzählen meine Bilder auch davon, wie wir Menschen unsere Umwelt gestalten oder mit ihr umgehen. Hauptsächlich im urbanen Raum. Ich bin damit aufgewachsen das Kleine zu schätzen und nicht immer nach dem Großen zu schauen. In Details steckt oftmals so viel drin, dass sie etwas über den größeren Rahmen, also unsere Gesellschaft und Zeit, Preis geben.



Wieviel Ironie und wieviel Ernst steckt in deinen Bildern?
Da ich viel fotografiere, sind meine Fotos erst einmal einer sehr starken Auswahl unterworfen. Wenn ich dann ein Bild, wirklich auch als Bild definiere, weil es mich auf eine gewisse Art und Weise anspricht, dann nehme ich es sehr ernst. Anstatt Ironie würde ich eher sagen, dass meine Bilder teilweise etwas Absurdes haben, indem ich Dinge oder Objekte von ihrer Umgebung, den Situationen oder Personen isoliere. Auf diese Weise bekommen sie ihr Eigenleben und das wirkt manchmal beinahe surreal. Ironie vielleicht in dem Sinne, dass ich teilweise über einiges schmunzeln muss. Auf keinen Fall steckt dahinter jedoch Sarkasmus. Ich möchte den Menschen mit Achtung begegnen.
Hat deiner Meinung nach jede Stadt ihre eigene Sprache oder ihren eigenen Code?
Definitiv jeder Ort. Natürlich bringt man sich immer selbst mit ein, aber jede Stadt, oder besser gesagt jeder Ort, verursacht in mir eine Stimmung. In Berlin zum Beispiel kann ich an verschiedenen Orten eine völlig unterschiedliche Stimmung spüren. Ich gehe grundsätzlich mit meiner inneren Emotion und Befindlichkeit auf die Straße. Aber je nachdem wie ich mich fühle, macht auch die Umgebung etwas mit mir. Und sobald ich eine Resonanz verspüre zwischen meinen inneren Gefühlen und dem was ich sehe, dann wird meist der Impuls ausgelöst durch den ich fotografiere.


Gibt es einen Ort an dem du immer wieder zurückgekehrt bist, weil er dir besonders viel gab?
Mitte der Neunziger fand ich Krakau unglaublich spannend, weil es eine Zeitreise zurück in meine Erinnerung war. Im Osten Deutschlands veränderte sich damals alles sehr schnell und sehr viel. Ich bin dann praktisch wieder zurück in die Zeit gereist. Generell mag ich jedoch immer neue Dinge und Orte zu entdecken. Auch Tbilisi, wo ich zweimal zum Kolga Fotofestival war, hat mir sehr gefallen, genauso wie Istanbul.
Wie bist du letztlich nach Palermo gekommen?
Ich glaube, dass war ein Traum. Wirklich. Ich habe schon seit zwei Jahren zu Leuten gesagt, dass ich unbedingt nach Palermo möchte. Ich hatte in Berlin bereits viele Leute getroffen, die von Palermo geschwärmt haben.
Seltsam. Wir kannten uns noch gar nicht.
Ja genau. Aber trotzdem bin ich aufmerksam auf die Stadt geworden. Nicht zuletzt durch Michela Palermo, die ich bei einem Workshop in Istanbul kennengelernt hatte. Als ich dann von der Liquida Studio Residency erfuhr, die von Minimum Studio und Baco about photographers organisiert wird, habe ich mich sofort beworben. Ich hatte ein so großes Bedürfnis nach diesem Projekt, dass ich es unbedingt wollte und Freunden im Vorfeld von meiner Bewerbung erzählte. Das mache ich nicht so häufig, spiegelte aber meinen starken Wunsch wider, an der Residency in Palermo teilzunehmen. Dass es tatsächlich geklappt hat, schien mir wie ein Wunder.

Jetzt bist du hier. Wie fühlt sich Palermo an?
Aufregend. Wie zu Hause. Also eigentlich nicht wie mein Zuhause, sondern eher so als könnte es mein Zuhause sein. Hier finde ich Kontraste, die aber nicht im Widerspruch zueinander stehen. Alles bleibt miteinander im Einklang, obwohl es so extrem viele Unterschiede gibt. Das ist beeindruckend.
Was hat die Arbeit hier in der Stadt für dich ausgemacht?
Zuerst hatte ich ein bisschen Bange davor. Als ich vom Flughafen angekommen bin und sah, dass alles so alt und traditionell wirkte, dachte ich: „Oh Gott, wie soll ich denn mit meiner Blickweise hier arbeiten?“ Oft treibe ich mich eher auf aufgeräumteren Plätzen herum, wo alles ein bisschen vorsortiert ist. Deswegen hatte ich leichte Bedenken, hier überhaupt zurechtzukommen und etwas produzieren zu können. Diese Angst ist dann aber schnell verflossen, als ich gemerkt habe, dass sich eine Art positive Aufregung breit machte. Ich habe versucht vorher nicht den Kopf einzuschalten, sondern mich erst einmal reinzustürzen und gleichzeitig zu fotografieren, um die Eindrücke mit der Kamera zu verarbeiten. Erst hinterher habe ich dann geschaut, was entstanden ist und wie ich es ergänzen könnte. Wie mein Mentor Wolfgang sagte: „Listen to the photographs“. Das ist extrem wichtig, weil es nicht nur bedeutet auf die Bilder zu hören, sondern auch auf uns selbst. Also nicht vorher zu sagen: So will ich sein und das bin ich jetzt dort. Sondern erst einmal zu schauen, wie man sich zu dem Zeitpunkt an der Stelle tatsächlich fühlt. Das spiegelt sich am Ende auch in den Bildern wieder.
Last but not least: Deine Frage:
Eigentlich stelle ich die Fragen lieber mit meinen Bildern. Ich versuche daher die Antwort offen zu lassen und würde mich freuen, wenn es mir mit den Fotos, die hier entstehen, gelingt.

Mehr Bilder, Bücher und Infos gibt es unter torstenschumann.de